|
|
Mit 10 der insgesamt 24 heute noch erhaltenen
Rolandstandbildern kann sich Sachsen-Anhalt durchaus als "Land der
Rolande" bezeichnen. Darüber hinaus besitzt das Rolandsymbol
mit den Standorten Bremen, Prag, Riga und Dubrovnik auch eine europäische
Dimension.
Den einzigen Reitenden
Roland (PDF - 55 KB) der Welt gibt es in Haldensleben gleich zweimal.
Das Original im Museum entstand 1528 zur Zeit Martin Luthers und vermittelt
zusammen mit anderen Kunstwerken und Architekturdetails ein anschauliches
Bild der Renaissance- und Reformationszeit in Haldensleben.
Marktplatz
 Auf dem Marktplatz erinnert an der Ecke zur Hagenstraße vor einem
1609 erbauten Bürgerhaus eine Steinplatte an den ursprünglichen
Standort des Reitenden Rolands (PDF - 55 KB) von 1528. Auf diesem funktionalen Mittelpunkt
der Stadt war das Reiterstandbild drehbar aufgestellt und konnte besonderem
Besuch zugewandt werden. Zuletzt geschah dies 1733 bei der Durchreise
des preußischen Königs.
Unweit hiervon findet sich der Standort des Breiten Steins. Dieser
Steintisch steht heute in der Nachbarschaft einer 1927 angefertigten
Rolandkopie vor dem Rathaus.
Auf dem Marktplatz erinnert an der Ecke zur Hagenstraße vor einem
1609 erbauten Bürgerhaus eine Steinplatte an den ursprünglichen
Standort des Reitenden Rolands (PDF - 55 KB) von 1528. Auf diesem funktionalen Mittelpunkt
der Stadt war das Reiterstandbild drehbar aufgestellt und konnte besonderem
Besuch zugewandt werden. Zuletzt geschah dies 1733 bei der Durchreise
des preußischen Königs.
Unweit hiervon findet sich der Standort des Breiten Steins. Dieser
Steintisch steht heute in der Nachbarschaft einer 1927 angefertigten
Rolandkopie vor dem Rathaus.

« zurück zur Ansicht "Stadtkern"
Breiter Stein
 Bisherige Theorien, wonach der Breite Stein ursprünglich als Pranger
oder Gerichtsstein diente und zudem aus dem 12. Jahrhundert stammte,
lassen sich durch nichts belegen. Vielmehr sprechen sein alter Standort
beim Roland von 1528 und die zentrale Drehachse in der runden Sandsteinplatte
dafür, dass es sich hierbei um den Sockel des 1419 erwähnten
ersten Rolands von Haldensleben handelt. Dieser war dann, wie seine
beiden Nachfolger, auch ein Reiterstandbild in Lebensgröße
und gleichfalls drehbar. Oder aber...
Bisherige Theorien, wonach der Breite Stein ursprünglich als Pranger
oder Gerichtsstein diente und zudem aus dem 12. Jahrhundert stammte,
lassen sich durch nichts belegen. Vielmehr sprechen sein alter Standort
beim Roland von 1528 und die zentrale Drehachse in der runden Sandsteinplatte
dafür, dass es sich hierbei um den Sockel des 1419 erwähnten
ersten Rolands von Haldensleben handelt. Dieser war dann, wie seine
beiden Nachfolger, auch ein Reiterstandbild in Lebensgröße
und gleichfalls drehbar. Oder aber...
« zurück zur Ansicht "Stadtkern"
Reitender Roland
 1528
schuf ein unbekannter Künstler das seit 1927 im Museum Haldensleben
befindliche Reiterstandbild aus grauem Sandstein. Vorbilder waren anscheinend
der Magdeburger Reiter und zeitgenössische Kaiserdarstellungen. Der
Reiter von Haldensleben
(PDF - 55 KB) stellt den gestalterischen Höhepunkt in der Entwicklung
der Rolandstandbilder dar. Im Gegensatz zu allen bis dahin geschaffenen
Standbildern verlieh der Künstler dem neuen Haldensleber Roland individuelle
Gesichtszüge und überwandt hierdurch das Symbolhafte des Mittelalters.
Neben dem ursprünglich farbig gefassten und mehrfach reparierten
Reiter ist im Museum auch der Rest des Rolandsockels mit Gesichtsdarstellungen
ausgestellt.
1528
schuf ein unbekannter Künstler das seit 1927 im Museum Haldensleben
befindliche Reiterstandbild aus grauem Sandstein. Vorbilder waren anscheinend
der Magdeburger Reiter und zeitgenössische Kaiserdarstellungen. Der
Reiter von Haldensleben
(PDF - 55 KB) stellt den gestalterischen Höhepunkt in der Entwicklung
der Rolandstandbilder dar. Im Gegensatz zu allen bis dahin geschaffenen
Standbildern verlieh der Künstler dem neuen Haldensleber Roland individuelle
Gesichtszüge und überwandt hierdurch das Symbolhafte des Mittelalters.
Neben dem ursprünglich farbig gefassten und mehrfach reparierten
Reiter ist im Museum auch der Rest des Rolandsockels mit Gesichtsdarstellungen
ausgestellt.

« zurück zur Ansicht "Stadtkern"
Fachwerk der Renaissancezeit
 In
der Museumsausstellung werden dem
Reitenden Roland Kunstwerke seiner Zeit, wie etwa die 1519 in der Werkstatt
Lucas Cranachs geschaffene Lucretia, gegenüber gestellt. Seinen ursprünglichen
Standort auf dem Marktplatz symbolisiert hier reich geschnitzte Fachwerkarchitektur.
Die drei zwischen 1554 und 1604 entstandenen Fassaden zeigen mit Fächerrosetten,
Rankenwerk und Blendarkaden als jeweilige Zierelemente ein Spektrum des
Renaissancefachwerks. Einige derartige Gebäude finden sich auch im
Stadtkern und verdeutlichen, dass im 16. Jahrhundert Haldensleben ein
ähnliches Aussehen wie Quedlinburg und Osterwiek hatte.
In
der Museumsausstellung werden dem
Reitenden Roland Kunstwerke seiner Zeit, wie etwa die 1519 in der Werkstatt
Lucas Cranachs geschaffene Lucretia, gegenüber gestellt. Seinen ursprünglichen
Standort auf dem Marktplatz symbolisiert hier reich geschnitzte Fachwerkarchitektur.
Die drei zwischen 1554 und 1604 entstandenen Fassaden zeigen mit Fächerrosetten,
Rankenwerk und Blendarkaden als jeweilige Zierelemente ein Spektrum des
Renaissancefachwerks. Einige derartige Gebäude finden sich auch im
Stadtkern und verdeutlichen, dass im 16. Jahrhundert Haldensleben ein
ähnliches Aussehen wie Quedlinburg und Osterwiek hatte.
« zurück zur Ansicht "Stadtkern"
Kühnesches
Haus
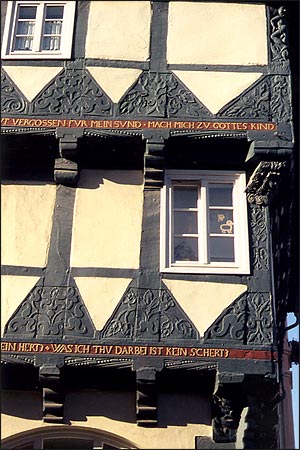 Das
1592 vom Ratsherren Joachim Lammspring an der Hagenstraße erbaute
Haus ist heute das Prachtstück Haldensleber Fachwerkarchitektur.
Neben der reichen Ornamentik mit Rosetten und Rankenwerk fallen besonders
die geschnitzten Masken der Eckknaggen auf. Im massiven Erdgeschoss sind
das Sitznischenportal zur Holzmarktstraße und ein figürlich
gestaltetes Sandsteinportal im Inneren sehenswert. Das Grundstück
kam 1764 in den Besitz der Familie Zersch. Der hier 1845 geborene Rudolf
Zersch erlangte später als Begründer von Brauerei und Ökonomiebetrieb
in Köstritz große Bedeutung.
Das
1592 vom Ratsherren Joachim Lammspring an der Hagenstraße erbaute
Haus ist heute das Prachtstück Haldensleber Fachwerkarchitektur.
Neben der reichen Ornamentik mit Rosetten und Rankenwerk fallen besonders
die geschnitzten Masken der Eckknaggen auf. Im massiven Erdgeschoss sind
das Sitznischenportal zur Holzmarktstraße und ein figürlich
gestaltetes Sandsteinportal im Inneren sehenswert. Das Grundstück
kam 1764 in den Besitz der Familie Zersch. Der hier 1845 geborene Rudolf
Zersch erlangte später als Begründer von Brauerei und Ökonomiebetrieb
in Köstritz große Bedeutung.
1875 erwarb der Goldschmidt Clemens Kühne das alte Eckhaus und
veranlasste dessen erste denkmalpflegerische Instandsetzung.
« zurück zur Ansicht "Stadtkern"
Alsteinsches
Haus
 Die heute einem Neubau vorgeblendete Fachwerkfassade des Alsteinschen
Hauses war bei der Entstehung 1589 ähnlich repräsentativ
wie die des Kühneschen Hauses. Trotz des fragmentarischen Erhaltungszustandes
besitzt das Haus an der Kirchstraße wegen des Bauherren große
stadtgeschichtliche Bedeutung. Joachim Alstein war wie sein älterer
Bruder Sebastian Rektor der Stadtschule und Bürgermeister von
Haldensleben. In ihrer Amtszeit ab 1593 bzw. 1606 bewirkten beide viel
positives und
bewahrten ihre Heimatstadt im 30jährigen Krieg vor Unheil. Die
Grabplatten der beiden Brüder sind bis heute in der Marienkirche erhalten.
Weitere Spuren der Brüder Alstein finden sich als Wappentafel
auf der Hofseite des Schulgebäudes am Marienkirchplatz (1596)
und am Stendaler Tor (1593).
Die heute einem Neubau vorgeblendete Fachwerkfassade des Alsteinschen
Hauses war bei der Entstehung 1589 ähnlich repräsentativ
wie die des Kühneschen Hauses. Trotz des fragmentarischen Erhaltungszustandes
besitzt das Haus an der Kirchstraße wegen des Bauherren große
stadtgeschichtliche Bedeutung. Joachim Alstein war wie sein älterer
Bruder Sebastian Rektor der Stadtschule und Bürgermeister von
Haldensleben. In ihrer Amtszeit ab 1593 bzw. 1606 bewirkten beide viel
positives und
bewahrten ihre Heimatstadt im 30jährigen Krieg vor Unheil. Die
Grabplatten der beiden Brüder sind bis heute in der Marienkirche erhalten.
Weitere Spuren der Brüder Alstein finden sich als Wappentafel
auf der Hofseite des Schulgebäudes am Marienkirchplatz (1596)
und am Stendaler Tor (1593).
« zurück zur Ansicht "Stadtkern"
Templerhaus
 Das Templerhaus ist das älteste erhaltene Fachwerkhaus der Stadt
und stammt aus dem Jahr 1553. Reste eines Vorgängerbaues aus dem
13. Jahrhundert haben sich auf dem Hof erhalten. Dies war anscheinend
der Stadthof der Tempelritter von Wichmannsdorf, welcher im 14. Jahrhundert
in den Besitz des Klosters Althaldensleben gekommen sein soll.
Da Mitte des 16. Jahrhunderts auch andere geistliche Orden ihren Besitz
in der Stadt verkauften, dürfte der Bauherr des bestehenden Templerhauses
weltlichen Standes gewesen sein. Der noch spätgotisch wirkende
Fachwerkbau erstreckte sich ursprünglich auch über eine links
anschließende Tordurchfahrt und besaß ein Sitznischenportal
im massiven Erdgeschoss.
Das Templerhaus ist das älteste erhaltene Fachwerkhaus der Stadt
und stammt aus dem Jahr 1553. Reste eines Vorgängerbaues aus dem
13. Jahrhundert haben sich auf dem Hof erhalten. Dies war anscheinend
der Stadthof der Tempelritter von Wichmannsdorf, welcher im 14. Jahrhundert
in den Besitz des Klosters Althaldensleben gekommen sein soll.
Da Mitte des 16. Jahrhunderts auch andere geistliche Orden ihren Besitz
in der Stadt verkauften, dürfte der Bauherr des bestehenden Templerhauses
weltlichen Standes gewesen sein. Der noch spätgotisch wirkende
Fachwerkbau erstreckte sich ursprünglich auch über eine links
anschließende Tordurchfahrt und besaß ein Sitznischenportal
im massiven Erdgeschoss.
« zurück zur Ansicht "Stadtkern"
Pressehaus
 Rechts neben dem Templerhaus an der Magdeburger Straße steht
eines der wenigen Massivbauten der Renaissancezeit in Haldensleben.
Einer Inschrift über dem Eingang zufolge wurde das Haus 1580 durch
den Magistrat der Stadt erbaut.
Die ursprüngliche Zweckbestimmung ist aber nicht überliefert.
1864 kaufte die Firma
C. A. Eyraud das Grundstück und betrieb hier neben Steindruckerei,
Buchdruckerei und Buchbinderei auch eine Leihbibliothek und eine Buchhandlung.
Eyraud gab zudem das Wochenblatt heraus, deren Tradition mit der Lokalredaktion
der Volksstimme bis heute fortlebt. Das Erdgeschoss des Pressehauses
wurde um 1900 grundlegend umgestaltet.
Rechts neben dem Templerhaus an der Magdeburger Straße steht
eines der wenigen Massivbauten der Renaissancezeit in Haldensleben.
Einer Inschrift über dem Eingang zufolge wurde das Haus 1580 durch
den Magistrat der Stadt erbaut.
Die ursprüngliche Zweckbestimmung ist aber nicht überliefert.
1864 kaufte die Firma
C. A. Eyraud das Grundstück und betrieb hier neben Steindruckerei,
Buchdruckerei und Buchbinderei auch eine Leihbibliothek und eine Buchhandlung.
Eyraud gab zudem das Wochenblatt heraus, deren Tradition mit der Lokalredaktion
der Volksstimme bis heute fortlebt. Das Erdgeschoss des Pressehauses
wurde um 1900 grundlegend umgestaltet.
« zurück zur Ansicht "Stadtkern"
Pfarrhaus
 Von den beiden Pfarrhäusern an der Burgstraße ist besonders
das zum Marktplatz hin gelegene Fachwerkhaus von Interesse. Ursprünglich
stand hier das Ordenshaus der Augustinermönche in Magdeburg. Die
Mönche wandten sich frühzeitig der Lehre Martin Luthers zu
und verkauften das Haus 1523 an den Rat der Stadt. Dieser führte
1542 auch in Haldensleben die Reformation ein und begründete 1549
eine zweite Pfarrstelle im alten Ordenshaus. Nach einem Großbrand
1661 wurde das Pfarrhaus in der heute bestehenden Form neu erbaut.
Typisch für das Fachwerk der Barockzeit sind "Bauerntänze" in
den Randgefachen.
Von den beiden Pfarrhäusern an der Burgstraße ist besonders
das zum Marktplatz hin gelegene Fachwerkhaus von Interesse. Ursprünglich
stand hier das Ordenshaus der Augustinermönche in Magdeburg. Die
Mönche wandten sich frühzeitig der Lehre Martin Luthers zu
und verkauften das Haus 1523 an den Rat der Stadt. Dieser führte
1542 auch in Haldensleben die Reformation ein und begründete 1549
eine zweite Pfarrstelle im alten Ordenshaus. Nach einem Großbrand
1661 wurde das Pfarrhaus in der heute bestehenden Form neu erbaut.
Typisch für das Fachwerk der Barockzeit sind "Bauerntänze" in
den Randgefachen.